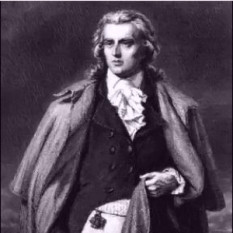Christian Johann Heinrich Heine (* 13. Dezember 1797 in Düsseldorf als Harry Heine; † 17. Februar 1856 in Paris) war einer der bedeutendsten deutschen Dichter und Journalisten des 19. Jahrhunderts.
Heine gilt als „letzter Dichter der Romantik“ und gleichzeitig als ihr Überwinder. Er machte die Alltagssprache lyrikfähig, erhob das Feuilleton und den Reisebericht zur Kunstform und verlieh der deutschen Sprache eine zuvor nicht gekannte elegante Leichtigkeit. Als kritischer, politisch engagierter Journalist, Essayist, Satiriker und Polemiker war er ebenso bewundert wie gefürchtet. Wegen seiner jüdischen Herkunft und seiner politischen Einstellung wurde Heine immer wieder angefeindet und ausgegrenzt. Die Außenseiterrolle prägte sein Leben, sein Werk und dessen wechselvolle Rezeptionsgeschichte. Die Werke kaum eines anderen Dichters deutscher Sprache wurden bis heute so häufig übersetzt und vertont.
Bedeutung und Nachleben
Aufgrund seiner Eigenständigkeit sowie seiner formalen und inhaltlichen Breite lässt sich Heines Werk keiner eindeutigen literarischen Strömung zuordnen. Heine geht aus der Romantik hervor, überwindet aber bald deren Ton und Thematik – auch in der Lyrik. Sein Biograf Joseph A. Kruse sieht in seinem Werk Elemente der Aufklärung, der Weimarer Klassik, des Realismus und des Symbolismus
Vor allem war er ein politisch kritischer Autor des Vormärz. Mit den Autoren des Jungen Deutschland, denen er bisweilen zugerechnet wird, verbindet ihn das Streben nach politischer Veränderung hin zu mehr Demokratie in ganz Europa, speziell in Deutschland. Dass er sich die Verwirklichung der Demokratie auch in einer konstitutionellen Monarchie wie der des Bürgerkönigs Louis-Philippe vorstellen konnte, brachte ihm Kritik von Seiten überzeugter Republikaner ein. Heines Distanzierung von der „Tendenzliteratur“, die er u.a. mit „gereimten Zeitungsartikeln“ verglich, erfolgte hingegen wohl weniger aus politischen als aus ästhetischen Motiven. Persönlich stand Heine Karl Marx und Friedrich Engels nahe, ohne jedoch deren politische Philosophie bis ins Letzte zu teilen.
Heine polarisierte schon seine Zeitgenossen, nicht zuletzt, weil er selbst polarisierende Urteile nicht scheute. Er griff tatsächliche oder vermeintliche Gegner ebenso hart an wie er selbst angegriffen wurde und schreckte vor keiner Polemik zurück. Nach seinem Tod nahm die Schärfe der Auseinandersetzungen um ihn eher noch zu – und sie hielt mehr als ein Jahrhundert an.
Symptomatisch dafür war der Streit um ein würdiges Heine-Denkmal in Deutschland. Nationalistisch und antisemitisch argumentierende Literaturwissenschaftler wie Adolf Bartels prägten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend die öffentliche Wahrnehmung Heines. Die seit 1887 anhaltenden Bemühungen, ihm in seiner Geburtsstadt Düsseldorf ein Denkmal zu setzen, denunzierte Bartels 1906 in seinem berühmt-berüchtigten Aufsatz „Heinrich Heine. Auch ein Denkmal“ als „Kotau vor dem Judentum“, ihn selbst als „Decadence-Juden“. Schließlich zog der Düsseldorfer Stadtrat 1893 seine Zustimmung zur Aufstellung eines Denkmals zurück, das der Bildhauer Ernst Herter geschaffen hatte. Die Darstellung der Loreley wurde schließlich auf eine Initiative von Deutsch-Amerikanern im New Yorker Stadtteil Bronx aufgestellt. Das erste Heine-Denkmal, das in Deutschland öffentlich errichtet werden konnte, war eine 1913 von Georg Kolbe für die Stadt Frankfurt am Main geschaffene allegorische Skulptur. Hugo Lederer schuf 1911 ein Heine-Denkmal für Hamburg, das jedoch schon 1933 beseitigt und später zerstört wurde. Kolbes Skulptur in Frankfurt ist die einzige ihrer Art, die Nazi-Zeit und Krieg überstand.
Im „Dritten Reich“ waren Heinrich Heines Werke verboten, und seine Bücher wurden zusammen mit denen zeitgenössischer Dichter Opfer der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland. Für die nach dem Krieg von Theodor W. Adorno verbreitete Behauptung des Germanisten Walter Arthur Berendsohn, Heines Loreley-Lied sei in Lesebüchern der Nazi-Zeit mit der Angabe „Dichter: unbekannt“ erschienen, fehlt allerdings bis heute jeder Beleg.
Selbst nach 1945 war die Aufnahme Heinrich Heines und seines Werkes in Deutschland noch lange Zeit ambivalent und Gegenstand vielfältiger Auseinandersetzungen, zu denen nicht zuletzt die deutsche Teilung beitrug. Während in der Bundesrepublik im restaurativen Klima der Adenauerzeit Heine eher zurückhaltend und höchstens als romantischer Lyriker rezipiert wurde, hatte die DDR ihn relativ schnell im Rahmen ihres „Erbe“-Konzeptes auf der Haben-Seite gebucht und bemühte sich um die Popularisierung seines Werkes, wobei vor allem „Deutschland. Ein Wintermärchen“ und sein Kontakt mit Karl Marx im Mittelpunkt des Interesses stand. Der erste internationale wissenschaftliche Heine-Kongress wurde im Gedenkjahr 1956 in Weimar veranstaltet, im selben Jahr erschien erstmals die fünfbändige Werkausgabe in der Bibliothek Deutscher Klassiker im Aufbau-Verlag. Der DDR-Germanist Hans Kaufmann legte 1967 die bis dahin bedeutendste Heine-Monografie der Nachkriegszeit vor.
Erst in den 1960er Jahren nahm auch in der Bundesrepublik das Interesse an Heine spürbar zu. Als Zentrum der westdeutschen Heine-Forschung etablierte sich allmählich seine Geburtsstadt Düsseldorf. Aus dem Heine-Archiv entwickelte sich schrittweise das Heinrich-Heine-Institut mit Archiv, Bibliothek und Museum. 1962 wurde die Veröffentlichung des Heine-Jahrbuchs begonnen, das schnell zum internationalen Forum der Heine-Forschung avancierte. Dennoch hielt der Streit um Heine an. Die geplante Benennung der Düsseldorfer Universität nach dem bedeutendsten Dichter, den die Stadt hervorgebracht hat, verursachte eine fast 20 Jahre währende Auseinandersetzung, die erst gegen Ende der 1980er Jahre beigelegt wurde. Offiziell seit 1989 gibt es in Heines Geburtsstadt die Heinrich-Heine-Universität und seit 1981 schließlich auch ein Heine-Denkmal, das von Bert Gerresheim gestaltet wurde. Darüber hinaus verleiht die Stadt Düsseldorf seit 1972 den Heinrich-Heine-Preis.
Abgesehen von diesen offiziellen Ehren erfuhr der politische Schriftsteller Heinrich Heine - forciert durch die Studentenbewegung - ein zunehmendes Interesse bei Nachwuchswissenschaftlern und politisch engagierten Lesern. Dass die Bundesrepublik in Sachen Heine-Rezeption mit der DDR gleichgezogen hatte, brachte die Veranstaltung zweier konkurrierender Heine-Kongresse im Jubiläumsjahr 1972 sinnfällig zum Ausdruck. Ein weiteres Resultat der deutsch-deutschen Konkurrenz waren die nahezu gleichzeitigen Erscheinungstermine der ersten Bände zweier groß angelegter historisch-kritischer Werkausgaben: der Düsseldorfer Heine-Ausgabe und der Heine-Säkularausgabe in Weimar.
In den 1980er Jahren nahm die ideologisch geprägte Auseinandersetzung um Heine spürbar ab und wich einer gewissen „Normalisierung“. Die Fachwissenschaft wandte sich bisher vernachlässigten Fragestellungen zu, u.a. dem späten Heine. Sein Werk fand zunehmend Aufnahme in die Lehr- und Lektürepläne von Schulen und Universitäten, was auch zu einer deutlichen Zunahme didaktisch orientierter Heine-Literatur führte. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die Heine-Renaissance mit den zahlreichen Veranstaltungen, die aus Anlass seines 200. Geburtstages im Jahr 1997 stattfanden.
Ungeachtet weltanschaulicher Auseinandersetzungen und fachwissenschaftlicher Paradigmenwechsel erfreut sich besonders Heines Lyrik ungebrochener Popularität, lassen sich doch seine romantischen, oft volksliedartigen Gedichte – allen voran das Buch der Lieder – erfolgreich mit der Musik verbinden (siehe unten). Im Theater hingegen ist Heine mit eigenen Stücken wenig präsent. Dagegen machte Tankred Dorst im Heine-Jahr 1997 den Dichter selbst zum Gegenstand eines Stückes: „Harrys Kopf“.
Zahlreiche Schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts griffen Heines Werke auf, darunter die großen Erzähler Theodor Fontane und Thomas Mann. Wie Heine wagten Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky die Gratwanderung zwischen Poesie und Politik. In der Tradition des Dichters stehen ebenfalls die Heine-Preisträger, so etwa Wolf Biermann und Robert Gernhardt. Heines Stil prägt den den Journalismus, insbesonders das Feuilleton, bis in die Gegenwart. Viele von ihm geprägte Begriffe gingen auch in die deutsche Alltagssprache ein, u.a. das Wort „Fiasko“, das er dem Französischen entnahm, oder die Metapher „Vorschusslorbeeren“, die er in dem gegen Graf Platen gerichteten Gedicht Plateniden verwendet.
Während die Rezeption Heines in Deutschland und Frankreich Höhen und Tiefen kennt, verlief die Aufnahme seiner Werke weltweit geradliniger. Heine war einer der ersten deutschen Autoren, dessen Werke in allen Weltsprachen zu lesen waren. So erklärt sich der Einfluss, den er auf andere Nationalliteraturen hatte. Auf besonders große Anerkennung trifft Heine außer in Frankreich auch in England, Osteuropa und Asien. So wurden einzelne Werke schon zu seinen Lebzeiten ins Japanische übersetzt.
Heine und die Musik
Heinrich Heine spielte selbst kein Musikinstrument und war auch in musiktheoretischen Fragen ein Laie. Da es nach seinem künstlerischen Verständnis aber keine strikten Grenzen zwischen verschiedenen Kunstformen gab, kommentierte er als Journalist – etwa in der Augsburger Allgemeinen Zeitung – immer wieder auch musikalische Aufführungen und Werke seiner Zeit; darunter auch solche von internationalen Größen wie Giacomo Meyerbeer, Franz Liszt, Robert Schumann oder Richard Wagner.
Auch in seine Lyrik floss sein Interesse für die Musik ein, etwa in das spöttische Gedicht ’’Zur Teleologie’’:
’’Ohren gab uns Gott die beiden,
Um von Mozart, Gluck und Hayden
Meisterstücke anzuhören -
Gäb es nur Tonkunst-Kolik
Und Hämorrhoidal-Musik
Von dem großen Meyerbeer,
Schon ein Ohr hinlänglich wär!
Trotz seiner fehlenden theoretischen Kenntnisse auf dem Gebiet der Musik, legten viele zeitgenössische Komponisten und Interpreten Wert auf seine Meinung, wahrscheinlich, weil sie ihm als Lyriker eine gewisse Kompetenz in musikalischen Fragen zugestanden. Dennoch wäre es nicht korrekt, Heine als Musikkritiker zu bezeichnen. Er war sich seiner begrenzten Fähigkeiten auf diesem Gebiet bewusst und schrieb stets als Feuilletonist, der sich der Thematik eines Stücks subjektiv und intuitiv näherte.
Von größerer Bedeutung als Heines Äußerungen über die Musik sind die musikalische Bearbeitung vieler seiner Werke durch Komponisten. Dies geschah erstmals im Jahr 1825 mit seinem Gedicht „Gekommen ist der Maie“, das Carl Friedrich Curschmann zu einem Lied verarbeitete.
In seinem Werk „Heine in der Musik. Bibliographie der Heine-Vertonungen“ listet Günter Metzner alle vertonten Werke des Dichters in chronologischer Reihenfolge auf. Für das Jahr 1840 verzeichnet er 14 Musiker, die 71 Stücke zu Werken von Heine komponierten. Vier Jahre später waren es bereits mehr als 50 Komponisten und 159 Werke. Der Grund für diesen rapiden Anstieg dürfte die Veröffentlichung des Lyrikbandes „Neue Gedichte“ bei Campe gewesen sein. Ihren Höhepunkt erreichte die Zahl der Heine-Vertonungen fast 30 Jahre nach dem Tod des Dichters, im Jahr 1884 – mit insgesamt 1093 Stücken von 538 Musikern und Komponisten. Nie zuvor und nie wieder danach wurden mehr Werke eines einzigen Dichters in einem Jahr zur Grundlage musikalischer Kompositionen. Insgesamt zählt Metzners Bibliografie 6.833 Heine-Vertonungen.
Darunter befinden sich Werke von Robert und Clara Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt, Peter Tschaikowsky, Alma Mahler-Werfel und Charles Ives. Unter anderem gehören Schumanns Liederkreis (Op. 24) und Dichterliebe (Op. 48) wie auch Schwanengesang von Schubert (D 957) zum regelmäßigen Repertoire von Konzerthäusern auf der ganzen Welt. Die populärste Heine-Vertonung in Deutschland dürfte Friedrich Silchers Lied „Die Lorelei“ sein.
Heines Bedeutung für das musikalische Schaffen hielt bis zum Ersten Weltkrieg an. Danach ließ der zunehmende Antisemitismus den „Heine-Boom“ weitgehend abflauen, bis er in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ganz zum Erliegen kam. Heute greifen Musiker und Komponisten Heines Werk erneut auf, darunter auch Opernkomponisten wie zuletzt Günter Bialas, dessen Oper „Aus der Matratzengruft“ 1992 uraufgeführt wurde. .
Sie können Informationen über die beste Musiksuchmaschine finden - Muzlan.top 😊Alle Materialien auf Anfrage "Heinrich Heine" finden Sie auf Seite Heinrich Heine
Ja natürlich. Sie können Titel auf der Seite Heinrich Heine anhören
Ja natürlich. Sie können Titel auf der Seite Heinrich Heine herunterladen
Diese Seite wird durch Abfragen gefunden: Heinrich Heine remix, Heinrich Heine track minus, Heinrich Heine mp3 download, Heinrich Heine flac, Heinrich Heine song download